Ziel erreicht: Der fahrerlose Truck im Straßenverkehr wird Realität

Wegweisendes Förderprojekt ATLAS-L4 zieht erfolgreiche Bilanz
- Umfangreiche Erprobungsphase mit wertvollen Erkenntnissen als Pionierarbeit für den Einsatz autonomer Nutzfahrzeuge auf Schnellstraßen und Autobahnen
- Erstmalige Anwendung des deutschen Gesetzes zum autonomen Fahren im Lkw-Hub-to-Hub-Verkehr
- Drei Jahre Forschungsarbeit von rund 150 Ingenieurinnen und Ingenieuren legen Grundstein für künftige Serienanwendungen für eine Logistik 4.0
- Abschlusspräsentation mit Fahrdemonstrationen, einer Ausstellung auf 1.000 Quadratmetern und zahlreichen Fachvorträgen in Penzing
Nach drei Jahren ziehen die zwölf Projektpartner aus Industrie, Wissenschaft, Softwareentwicklung und Infrastruktur eine erfolgreiche Bilanz beim Forschungs- und Entwicklungsprojekt ATLAS-L4 (Automatisierter Transport zwischen Logistikzentren auf Schnellstraßen im Level 4): Der autonome Truck im Straßenverkehr wurde dank der Arbeit von rund 150 Ingenieurinnen und Ingenieuren Realität! MAN Truck & Bus, Knorr-Bremse, LEONI, Bosch, FERNRIDE, BTC Embedded Systems, Fraunhofer AISEC, Technische Universität München, Technische Universität Braunschweig, TÜV SÜD, Autobahn GmbH und das Würzburger Institut für Verkehrswissenschaften (WIVW GmbH) haben dafür ihre Kräfte gezielt gebündelt.
Das Konsortium hatte sich in dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten und mit einem Gesamtbudget von 59,1 Millionen Euro ausgestatteten Projekt ein klares Ziel gesetzt: einen Level-4-automatisierten und damit autonom fahrenden Lkw für den Hub-to-Hub-Transport auf die Schnellstraßen zu bringen. Basis dafür war das 2021 verabschiedete Gesetz, das autonomes Fahren auf fest definierten Strecken unter einer technischen Aufsicht grundsätzlich ermöglicht und Deutschland damit global in eine Vorreiterrolle bringt.
»Wir haben uns zusammen mit unseren Partnern ein hohes Ziel gesetzt und ein industrialisierbares Basiskonzept für das autonomen Fahren im Hub-to-hub Einsatz verwirklicht. Die Entwicklung und Integration der für den sicheren Einsatz notwendigen redundanten Komponenten wie Lenkung, Bremse und Bordnetz sowie das Erstellen eines Validierungskonzeptes erforderte interdisziplinäre Kompetenz und enge Teamarbeit. Als Konsortium haben wir mit dem Projekt bewiesen: Autonom fahrende Lkw sind realisierbar!« resümiert Dr. Frederik Zohm, Vorstand für Forschung und Entwicklung bei MAN Truck & Bus und ergänzt: »Innovationen wie das autonome Fahren erfordern solche Kooperationen, um Zukunftstechnologie in Deutschland und Europa effektiv voranzubringen«.
Wie verlief die Erprobungsphase?
Am 1. Januar 2022 fiel der Startschuss für ATLAS-L4. Nachdem das Kraftfahrt-Bundesamt im April 2024 die erste Level-4-Erprobungsgenehmigung für einen Nutzfahrzeughersteller erteilt hatte, fand die Premiere im öffentlichen Straßenverkehr mit der ersten Autobahnfahrt eines autonomen Lkw in Deutschland statt – mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing als prominenten Begleiter. Bei dieser und allen weiteren Erprobungsfahrten war immer ein Sicherheitsfahrer an Bord. Die Automatisierungs-Software im Fahrzeug wurde durch regelmäßige Releases kontinuierlich über einen langen Zeitraum hinweg optimiert und direkt in der Praxis erprobt.
Mission erfüllt!
Das Konsortium konnte an alle Projektziele einen Haken setzen: Die für die Level-4-Architektur sicherheitsrelevanten Komponenten wie redundantes Bremssystem, Bordnetz und Lenkung wurden aufgebaut. Ein Validierungskonzept wurde erstellt, parallel das Control Center für die technische Aufsicht in Betrieb genommen. Risikoanalysen und Safety-Betrachtungen für das Level 4 – inklusive Cybersicherheit, etwa in Form von authentischer und verschlüsselter Kommunikation, sowie die Definition von funktionalen Sicherheitsmaßnahmen wie Redundanzen und Degradationskonzepten für das autonome Fahrsystem – fanden statt. Das Ergebnis: eine prototypische Technologie als Blaupause für weitere Projekte und Serienentwicklungen.
Cybersicherheit für autonome Trucks
Das Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit AISEC analysierte in Zusammenarbeit mit dem Konsortium das Cybersicherheitsrisiko für die neue Architektur des autonomen Fahrzeugs und für das Control Center. Mithilfe erweiterter Methoden für Cybersicherheits-Risikoanalysen, die sowohl den Level-4-Kontext als auch die Fahrzeug-Perspektive und die Spezifika weiterer Domänen wie IT-Backend und Produktion berücksichtigen, spielten die Expertinnen und Experten umfangreiche Angriffsszenarien durch und entwickelten passgenaue Schutzkonzepte.
Ferner hat das Fraunhofer AISEC Cybersicherheitsstandards aus spezifischen Automotive-Domänen sowie zu Themenfeldern wie Post-Quanten-Kryptografie, Usability und Machine Learning analysiert und übergreifend verglichen, um einen ganzheitlichen Sicherheitsansatz über alle relevanten Bereiche hinweg zu erreichen. Die Forschenden erarbeiteten Konzepte für ein bereichsübergreifendes Cybersicherheits-Risikomanagement und entwickelten Werkzeuge für Pentesting und Security-Code-Reviews weiter.
Die Expertise des Fraunhofer AISEC ermöglicht Herstellern, den Ansatz »Security by Design« bei der Entwicklung autonomer Serien-Lkw und deren Ökosystem konsequent umzusetzen, indem sie Cybersicherheitsmaßnahmen frühzeitig integrieren und fortlaufend verifizieren.
Wie geht es weiter?
Die Arbeit von ATLAS-L4 kann folglich als Basiskonzept für künftige industrielle Entwicklungen genutzt werden, wobei für einen autonomen Truck in Serie noch diverse Detailfragen geklärt werden müssen, die das Projekt aufgezeigt hat. »Wir haben wertvolle Pionierarbeit geleistet, indem wir für die technische Machbarkeit von autonomen Trucks den praktischen Nachweis erbracht haben«, so Projektkoordinator Sebastian Völl, MAN Truck & Bus. »Diese Konzepte fließen nun in die weitere Entwicklungsarbeit zur Serienentwicklung von autonomen Lkw ein.«
Denn Logistik 4.0 bietet viel Potenzial: Fahrerlose Lkw als Teil einer Hub-to-Hub-Automatisierung für Pendelfahrten zwischen Logistikhöfen können einen wichtigen Beitrag zu mehr Effizienz sowie zur Vermeidung von Staus und Unfällen leisten. Auch für den Fahrermangel, an dem die Branche seit Jahren leidet, bieten Automatisierungskonzepte einen Lösungsansatz. Schon heute fehlen in Deutschland etwa 100.000 Lkw-Fahrer.
Am 7. und 8. Mai präsentierten die Projektbeteiligten etwa 200 Gästen im Beisein von Vertretern des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz die Ergebnisse von ATLAS-L4 – mit Fahrdemonstrationen auf dem Gelände des ADAC Testzentrums Mobilität in Penzing und auf der Autobahn, einer Ausstellung auf rund 1.000 Quadratmetern und wissenschaftlichen Fachvorträgen.
Breit gefächerte Kompetenz:
Der Nutzfahrzeughersteller MAN Truck & Bus war im Projekt verantwortlich für die Gesamtsystementwicklung und die Integration aller Komponenten in das Fahrzeug. Auch die Datenübertragung zum Fahrzeug und die Inbetriebnahme des Control Centers, der im Sinne der im Gesetz zum autonomen Fahren vorgesehenen technischen Aufsicht, lagen in der Verantwortung von MAN.
Das Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit AISEC erweiterte im Projekt erstmalig seine Methoden für Cybersicherheits-Risikoanalysen auf automatisierte Lkw und forschte an Lösungen für ein holistisches Security-Management. Auf dieser Grundlage wurden Security-Risikoanalysen sowie Schutzkonzepte für die Lkw und ihr Ökosystem entwickelt.
Knorr-Bremse, Weltmarktführer für Bremssysteme, entwickelte die spezielle, redundant ausgelegte Bremssystemarchitektur inklusive Lenkungsredundanz durch Steer-by-Brake, die den sicheren Betrieb eines Level-4-Lkw in jeder Situation ermöglicht.
Der Projektpartner LEONI, Europas größter Bordnetzhersteller, stellte sicher, dass das Bordnetz und die elektronische Leitungsverteilung des Automatisierungssystems unabhängig von möglicherweise auftretenden Fehlern immer zuverlässig funktionieren.
Die Robert Bosch Automotive Steering GmbH entwickelte ein fehlertolerantes Lenksystem für ATLAS-L4, das alle Anforderungen für die SAE-Level-4-Automatisierung erfüllt.
Das Münchner Startup FERNRIDE GmbH, das sich auf autonomes Fahren auf Logistikgeländen spezialisiert hat, untersuchte die Möglichkeiten von Teleoperation im vom Projekt adressierten Hub-to-hub-Szenario. Mit FERNRIDEs Teleoperations-Technologie können autonome Fahrzeuge überwacht und bei Bedarf ferngesteuert werden.
Der Test-Tool-Hersteller BTC Embedded Systems AG widmete sich szenarienbasierten und simulativen Testansätzen zur Gesamtfahrzeugverifikation und Sicherheitsvalidierung unter besonderer Berücksichtigung von kritischen Fahrsituationen.
Das Institut für Regelungstechnik der TU Braunschweig erarbeitete unter anderem Konzepte für den sicheren Betrieb von Level-4-Lkw sowie für die technische Self-Awareness von automatisierten Fahrzeugen.
Der Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik der TU München steuerte seine Expertise hinsichtlich verschiedener Fahrdynamikaspekte bei und erarbeitete Interaktionskonzepte für die technische Aufsicht.
TÜV SÜD brachte bei den Projekttestfahrten seine umfassende Erfahrung mit Testumgebungen für automatisierte Fahrzeuge ein, testete dabei die Fähigkeiten der Fahrzeuge selbst sowie die Validität der Simulation und bewertete im Rahmen des Freigabeprozesses die Sicherheit der Fahrzeuge.
Mit dem Gesetz zum autonomen Fahren fällt die Genehmigung von Betriebsbereichen auf Autobahnen in die Zuständigkeit der Autobahn GmbH. Im Rahmen des Projekts entwickelte sie ein digitales Managementsystem für die Betriebsbereichsgenehmigung und brachte ihre langjährige Expertise im Bereich des kooperativen und vernetzten Fahrens in das Projekt ein.
Die WIVW GmbH baute einen Teleoperator-Arbeitsplatz auf, der durch die Kopplung mit der Fahrsimulation die Steuerung eines virtuellen Lkw erlaubt. Die erarbeiteten Anforderungen an einen Teleoperator-Arbeitsplatz können so in ein konkretes Konzept umgesetzt, implementiert, visualisiert und evaluiert werden.
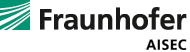 Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit
Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit